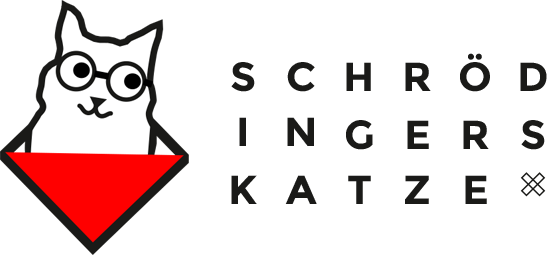Das Österreichische Institut für Familienforschung an der Universität Wien untersuchte in einer Studie, wie Führungskräfte männliche Arbeitskräfte bewerten, die mehr Betreuungspflichten übernehmen und ihre Arbeitszeit verringern möchten. Konkret wurde gefragt, ob es den Führungskräften lieber ist, wenn ein Mitarbeiter eine Weile in Karenz geht oder auf Dauer seine Arbeitszeit von 40 auf 25 Stunden reduziert. „Ein zentrales Ergebnis ist, dass unter den 400 befragten Führungskräften ein überwiegender Teil angibt, das Anliegen des Mitarbeiters selbst zu unterstützen und auch dass das Unternehmen das Anliegen unterstützen würde“, so Andreas Baierl und Eva-Maria Schmidt, die gemeinsam für die Studie verantwortlich zeichnen.
Flexible Führungskräfte
Den Großteil der Befragten ist eine Verringerung der Arbeitszeit lieber. Dazu sagen die beiden Expert*innen: „Das Antwortverhalten erscheint nachvollziehbar, da eine Elternkarenz bedeutet, dass der Mitarbeiter – wenn auch nur für begrenzte Zeit – nicht greifbar ist.“ Das Geschlecht der Führungskraft ist nicht ausschlaggebend für das Maß an Unterstützung, auch hinsichtlich der Branche ergaben sich keine Unterschiede, wobei der Experte betont, dass Führungskräfte solcher Unternehmen, die bereits auf Teilzeit und flexible Arbeitsmodelle setzen, besonders unterstützend agieren.
Wenige Väter in Karenz
Die Unterstützung vonseiten der Führungskräfte wäre also vorhanden, dennoch gehen in Österreich nur wenige Männer in Karenz: Die Datenlage dazu ist schlecht, so wird nicht erhoben, wie viele Männer tatsächlich in Karenz sind. Es gibt lediglich Zahlen dazu, wie viele Männer Kinderbetreuungsgeld beantragen, das muss aber nicht heißen, dass diese Väter auch tatsächlich in Karenz gehen, wie das Nachrichtenmagazin profil berichtete. Aktuelle Zahlen des Bundeskanzleramte zeigen, dass 2019 14.270 Väter Kinderbetreuungsgeld bezogen.
Das Wiedereinstiegsmonitoring der Arbeiterkammer zeigt ebenso, dass nur wenige Männer länger in Karenz sind: Konkret gehen nur drei Prozent der Väter in Partnerschaften länger als drei Monate in Karenz. Die Politik will daher fördern, dass Väter ihre Karenzzeiten in Anspruch nehmen: So kann die volle Elternkarenz von 24 Monaten nur in Anspruch genommen werden, wenn der zweite Elternteil (ergo die Väter) zumindest zwei Monate in Karenz gehen.
Elternrollen und Stereotype
„Elternrollen- und damit zusammenhängende Wertvorstellungen sind in Österreich eher traditionell“, erklären Baierl und Schmidt. Mütter wünschen sich, ein oder zwei Jahre beim Kind zu bleiben und kehren dann oft als Teilzeitkraft in den Arbeitsmarkt zurück. Männer sehen sich wiederum primär für das Familieneinkommen verantwortlich. „Im bestehenden System der Elternkarenz und des Kinderbetreuungsgeldes lässt sich dieses Modell weitgehend verwirklichen. Besteht der Wunsch des Vaters nach einer anderen Rollenaufteilung, sind Aushandlungsprozesse notwendig: mit seiner eigenen Identität als Mann, mit der Partnerin und mit dem privaten und beruflichen Umfeld.“
Geeignete Maßnahmen
Maßnahmen für mehr Familienfreundlichkeit, die Unternehmen bereits umsetzen, reichen von Gleitzeit, zu Home-Office oder Teilzeitmodellen. Obwohl sich diese an alle Geschlechter richten, werden sie zumeist von Frauen in Anspruch genommen. „Es müssten Väter verstärkt spezifisch angesprochen werden: Nicht übertragbare Zeiten von mindestens vier Monaten würden dazu führen, dass auch von Vätern erwartet wird, für einige Zeit ihre Berufstätigkeit zu unterbrechen und anschließend eventuell zu reduzieren“, schlussfolgern Andreas Baierl und Eva-Maria Schmidt.