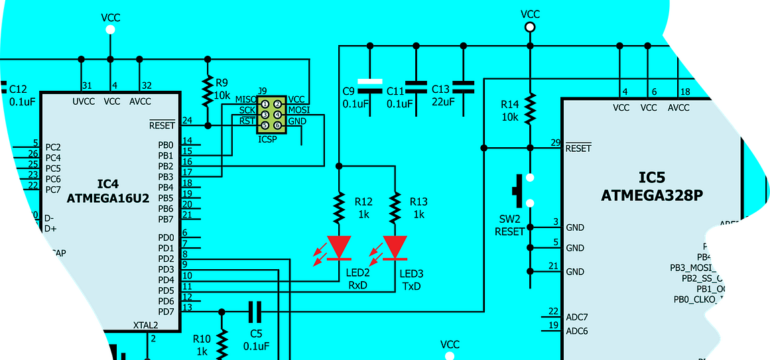Technologien kennen meist nur Männer und Frauen, wie aber nicht-binäre Personen – also Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau identifizieren – technologisch verhandelt werden, dies ist meist ein blinder Fleck in Wissenschaft und Praxis. Katta Spiel Post-Doc an der TU Wien und Lehrperson an der Universität Wien, befasst sich jedoch genau mit solchen Fragestellungen: Spiels Forschung fokussiert auf marginalisierte Perspektiven auf Technologie an den Schnittstellen von Informatik, Design und Kritischer Theorie. So geht Spiel etwa der Frage nach, welche Auswirkungen es auf Ansätze maschinellen Lernens und den Umgang mit großen Datenmengen hat, wenn nur das als valide gilt, das in den herkömmlichen Datenbanken abgebildet wird.
In ihrem Vortrag „Als Mensch zählen. Geschlechtsbasierte Ein- und Ausschlüsse in digitalen Technologien“ (hier nachzusehen) hat Spiel genau diese Schnittstellen beleuchtet.
Im Interview erinnert Spiel daran, dass es viele unterschiedliche digitale Technologien gibt. Als Beispiel für einen geschlechtsbasierten Ein- und Ausschluss digitaler Technologien nennt sie Algorithmen, die etwa aus einem Gesicht ein Geschlecht ablesen. Diese Daten basieren dabei auf Datenmaterial, das nur zwei Geschlechter kenne und nur daraufhin trainiert worden sei. Problematisch sei dies dann, wenn Personen eben keines dieser Geschlechter haben. „Es wird also ganz oft davon ausgegangen, dass Geschlecht berechnet, ‚erkannt‘ oder in Daten abgebildet wird, aber oft verstehen dann die Personen, die diese Programme implementieren gar nicht, was Geschlecht eigentlich ist. Zumindest nicht in der Tiefe, die es dafür aus meiner Perspektive bräuchte“, so Spiel weiters.
Technologien und Geschlecht: Was ist für wen gemacht?
Wie sollten Technologien also gestaltet sein, um nicht diskriminierend zu agieren? Spiel ist nicht der Ansicht, dass jede Technologie „für alle alles machen soll“. Aber Spiel erinnert daran, dass wir uns alle mehr damit auseinandersetzen müssten, „für wen bestimmte Dinge eigentlich gemacht sind und noch viel mehr für wen nicht“. Als konkretes Beispiel hierfür nennt Spiel den Fitness-Tracker: „Wenn ein Fitness-Tracker gestaltet, entwickelt und letztlich vermarktet wird, wird maßgeblich von den positiven Interaktionsmöglichkeiten ausgegangen und weniger davon, was eigentlich passiert, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. So sind beispielsweise Krankheiten nicht vorgesehen. Wenn eine Person eine Woche lang die Zielvorgaben nicht erfüllen kann, wird das in den Spielelementen dahinter als ’nicht geschafft’ gewertet. Wenn eine Person aus religiösen Gründen an manchen Tagen keine technischen Geräte verwendet, wird dies als ’nicht geschafft’ gewertet. Es wird eine Regelmäßigkeit angenommen, die im alltäglichen Leben einfach nicht hält – zumindest nicht für alle.“
Zudem betont Spiel, dass technische Produkte als Produkte für alle vermarktet werden, obwohl sie oft die Interessen und Perspektiven einer bestimmten Gruppe abbilden, nämlich die der weißen, männlichen und Menschen ohne Behindertenstatus. Diese seien überproportional in der Gestaltung der Technik vertreten. „Wenn wir nicht reflektieren, welche Personengruppen bei so einem Prozedere immer ausgeschlossen werden, bringt es wenig, das daran festzumachen, wer die Technologien gestaltet. In vielerlei Hinsicht ist die Frage auch eher: Wer finanziert was mit welchen Interessen?“, erinnert Spiel.
Interdisziplinarität in der Technik
Fragestellungen, wie die nach Technik und Geschlecht, bedingen geradezu Interdisziplinarität. Inwiefern Technik von etwa den Geisteswissenschaften profitieren kann bzw. vice versa, dafür ist Katta Spiel ein gutes Beispiel: Spiel selbst vereint Technik und Geisteswissenschaft: So absolvierte Spiel in der Grundausbildung Studien der Medienkultur (B.A.), Mediensysteme (B.Sc.) sowie Computer Science and Media (MSc.).
Angesprochen darauf, inwiefern Gender Studies und Interdisziplinarität gerade im technischen Bereich helfen, um Probleme zu lösen, antwortet Spiel: „In meiner Arbeit habe ich gesehen, dass es extrem befruchtend für sowohl Technikbereiche als auch die Geisteswissenschaften sein kann, in einen gegenseitigen respektvollen Austausch zu treten. Dabei geht es auch darum zu verstehen, dass manche Probleme vielleicht gar nicht immer eine (technische) Lösung brauchen, sondern manchmal einen Prozess der Aushandlung benötigen, in der Technologie manchmal, aber eben auch nicht immer hilfreich sein kann. Wir beschäftigen uns leider in der Informatik auch viel zu wenig damit wann technologische Ansätze eigentlich nicht sinnvoll sind. Interdisziplinäre Teams tragen generell auch dazu bei, dass Probleme tiefergehender diskutiert werden und eben mehr Perspektiven eingebunden sind, was technische Herangehensweisen zumindest das Potential gibt, flexibler auf unterschiedliche Lebensrealitäten zu agieren.“