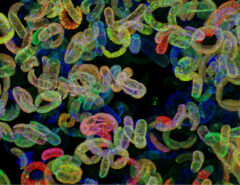Der Ökologe Andreas Richter von der Uni Wien fährt seit einigen Jahren regelmäßig für seine Forschung in die Arktis. Schrödingers Katze hat er von seiner Expedition im Frühjahr erzählt.

Foto: Andreas Richter.
Schneestürme und Eisbären
Ort: Inuvik, die kanadische Arktis. Die Temperaturen fallen im Winter auf bis zu Minus 20 Grad, Schneestürme stehen an der Tagesordnung, Eisbären und Moschusochsen rennen frei herum. Hier hat der Ökologe Andreas Richter, gemeinsam mit einem Team aus ForschungskollegInnen, im April fast zwei Wochen verbracht.
Die Wohnverhältnisse in der Arktis sind meist, wenig überraschend, bescheiden. „Prinzipiell sind Winterexpeditionen im Zelt keine gute Idee“, sagt Richter. Sommerexpeditionen würden allerdings durchaus im Zelt durchgeführt. Die Hütte, in der die ForscherInnen stattdessen im April nächtigten, wurde ehemals von Jägern bewohnt. Sie hat weder Strom noch fließendes Wasser. Im Gegensatz zu einem Zelt kann sie allerdings beheizt werden.

Gefrorene Bohrkerne
Für gewöhnlich führt Richter auch keine Expeditionen im Winter durch, doch in diesem Jahr ging es nicht anders. Denn der Ökologe wollte gefrorene Bohrkerne aus dem arktischen Boden nach Wien bringen. Der Permafrostboden in der Arktis kann uns viel über das Klima der vergangenen Jahrtausende erzählen, und darüber, wie es mit dem Klima heute weitergeht.
Die Bohrkerne müssen die ganze Zeit über gefroren bleiben damit sie sich durch das Auftauen nicht verändern und die Untersuchungsergebnisse verfälscht werden. Damit sie nicht kontaminiert werden, fasst Richter die gefrorenen Bohrkerne nur mit dünnen Einweghandschuhen an. „Man kann sich sicher gut vorstellen, dass das dann schnell sehr unangenehm wird“, sagt der Ökologe.
Unangenehm seien auch die Wetterbedingungen. Ab und zu kommt es nämlich zu einem „White-Out“, also einen Sturm, durch den der weiße Boden und der Himmel zu einer weißen Masse verschwimmen. Trotz der Gefahr meint Richter, seien ForscherInnen keine Abenteurer. Man passe immer aufeinander auf.

Alltag im ewigen Eis
Die Arktis ist nicht gerade Touristengegend. Um dorthin zu kommen, hat Richter im April insgesamt sieben Flüge gebraucht. Vor Ort fahren die ForscherInnen mit Skidoos jeden Tag mehrere Stunden von der Hütte zu den Stellen, an denen sie Bohrkerne entnehmen wollen. Die Navigation funktioniert mit GPS, denn als Fremde finden sie sich in der durchgehend weißen Landschaft nicht zurecht. Geführt werden die ForscherInnen von Einwohnern, in diesem Fall waren es Inuit.
„Diese Jäger sind darauf trainiert, auf ganz kleine Details zu achten und können sich dadurch orientieren. Wir würden da nie mithalten können“, meint Richter. Die Inuit, die sie führen, sind auch bewaffnet, um im Notfall auf einen Angriff durch Eisbären oder Moschusochsen reagieren zu können.
Nach einem zwölfstündigen Arbeitstag in der Kälte, am dem sie Bohrungen durchgeführt und die Bohrkerne verladen haben, fahren die ForscherInnen wieder zurück in ihre beheizte Hütte, die sie sich zu siebt teilen. Verträgt man sich dort auch immer unter Kollegen auf so engem Raum? Richter winkt ab. „Es entstehen meist sehr gute Gemeinschaften, denn es ist nur eine kleine Gruppe von Gleichgesinnten, die sich überhaupt auf solche Expeditionen einlässt.“