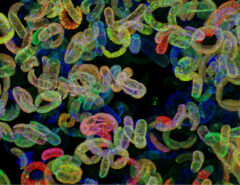Kein alltägliches Treffen. Schrödingers Katze sitzt mit einem Nobelpreisträger im Senatssitzungssaal der Universität Wien. Knapp 30 Minuten dauert das Gespräch. Jede Sekunde davon nützt der drahtige Physiker. Selbst als er für seinen Vortrag im Rahmen der Erwin Schrödinger Distinguished Lecture verkabelt wird, spricht er weiter. Chu ist eine Effizienz-Bestie. Selbst auf Reisen kann er den Blick des ehemaligen Umweltministers nicht ablegen. Dabei ging es dem 66-jährigen Physiker nicht immer um den Klimawandel. Chu denkt pragmatisch. „Mit 30 habe ich mein erstes Haus gekauft. Schon seit damals interessiere ich mich privat für den Energiehaushalt. Nicht weil ich mir Sorgen um den Klimawandel gemacht hätte. Ich habe es einfach gehasst, Geld hinauszuwerfen.“ Ein Gespräch über Ideen aus der Dusche, Supernerds und die Verkommenheit der amerikanischen Politik.
Von 2009 bis 2013 war Steven Chu amerikanischer Umweltminister. Die Havarie der Deep Water Horizon fiel in seine Amtszeit. Barack Obama persönlich ernannte Chu zum Leiter der Rettungsmission. Chu ist ein ruhiger, schmächtiger Mann. Besonnen richtet er sich bei seinen Antworten die Brille. Nach Benjamin Franklin war Chu der erst zweite Wissenschaftler in einem US-Kabinett. Ein Wissenschaftler mit großer Verantwortung, denn sein Energieministerium regelte nicht nur Umweltfragen, sondern hatte auch die Aufsicht über das amerikanische Nuklear-Arsenal.
Haben Sie als Politiker die Wissenschaft vermisst?
„Ja und nein. Ich war ein Bürokrat und stand einer großen Einrichtung vor. Mit einem Budget von 26 Milliarden Dollar pro Jahr, sie sind der Boss von 126.000 Menschen. Aber ich war dazu bereit, weil es wirklich wichtige Projekte im Energieministerium gab. Das Ministerium ist der größte Geldgeber der Naturwissenschaften, es ist verantwortlich für das amerikanische Atomarsenal, es ist der größte Geldgeber von Untersuchungen zur Energienutzung. Viele dieser Dinge sind wirklich relevant. Ich habe das so gelöst: Ich habe viele Hobbies, ins Kino gehen, Flugzeuge fliegen, Bücher lesen – all das habe ich aufgehört. Weil ich jede Sekunde meiner Freizeit wissenschaftlich gearbeitet habe. Ich habe Papers verfasst, Post-Docs betreut und so weiter. Meistens am Wochenende oder während langer Flüge habe ich also wieder Papers verfasst.“
Wie konnten Sie überhaupt noch über Wissenschaft nachdenken?
„Ich kann im Hintergrund-Modus arbeiten. Als Minister habe ich 60 bis 70 Stunden in der Woche gearbeitet, das ist ein 24/7 Job, man ist immer gerüstet und erreichbar. Aber im Hintergrund-Modus kann man dennoch über Wissenschaft nachdenken. Ich habe das bemerkt, als ich einem staatlichen Labor vorstand (Lawrence Berkeley National Laboratory, Anm.) Sogar während Meetings in denen es um die Angelegenheiten des Labors ging, war mein Hintergrund-Modus eingeschaltet. Wenn ich dann am Wochenende mit meinen Post-Docs telefoniert habe, manchmal Wochen nach dem letzten Gespräch, konnte ich mich an unser letztes Gespräch erinnern. Nicht nur das, meine Überlegungen sind vorangeschritten. Unbewusst. Das Beste daran war aber: Wissenschaft wurde zum Hobby. Zu meinem einzigen Hobby.“

Wie viel Schlaf bekommt ein US-Minister?
„Durchschnittlich 7 Stunden, schätze ich. Aber das Nachdenken im Hintergrundmodus, darauf kommt es an. Die meisten erkennen nicht, dass sie diesen Modus haben. Im Hintergrundmodus versuchen sie nicht, bewusst ein Problem zu lösen oder einen neuen Ansatz zu entwickeln. Sie lösen das obwohl sie nicht am Schreibtisch sitzen und grübeln. Sehr häufig haben Wissenschaftler ihre besten Ideen unter der Dusche oder beim Klettern. Oder bei mir: während des Fahrradfahrens. Wenn ich mich einen Berg hinaufquäle und mich darauf konzentriere, Luft zu bekommen, dann kommen die Ideen. Plötzlich. Ganz ohne Zwang.“
Verspüren Sie da keinen Druck? Wenn Sie während der kostbaren Auszeit am Wochenende radelnd auf die Lösung eines Problems warten?
„Nein, überhaupt nicht. Und wenn Leute Druck verspüren, beim Duschen oder sonst wo, dann sollten sie ihren Lebensstil ändern.“
Sie haben ja einen Rat für junge KollegInnen: eine eigene Sprache finden, sich im Erklären wohlfühlen lernen. Nicht einfach nur nachzuplappern, sondern den eigenen Gedanken auch eigene Worte spenden. Wie nützlich war diese Fähigkeit in der Politik?
„Sehr nützlich. Das ist für das ganze Leben nützlich. Wenn man glaubt, etwas zu verstehen, dann versteht man es erst dann wirklich, wenn man es in eigenen Worten ausdrücken kann. Wenn sie es auf jedem erdenklichen Niveau für jedes erdenkliche Publikum, erfahren oder unerfahren, ausdrücken können – dann haben sie es verstanden. Ich habe diese Fähigkeit über viele Jahre entwickelt. Wenn ich etwas verstanden habe, war ich wirklich begeistert und habe es allen erzählt. Ich habe Menschen aufgelauert um ihnen mitzuteilen, dass ich etwas kapiert habe. Die mussten mir dann 10 Minuten zuhören. (lacht) Ich war einfach so, aber durch das darüber Reden, habe ich es auch selbst besser verstanden. Aber so selten ist das auch wieder nicht. Wissenschaftler sind soziale Wesen, sie reden gerne, sie tauschen sich gerne aus. Die Idee, dass sich ein Supernerd in sein Kämmerchen sperrt und in gediegener Isolation einen großen Wurf landet, entspricht meistens nicht der wissenschaftlichen Realität.“
Unis und Wissenschaft haben es aber doch schwer, ihre Botschaften anzubringen.
„Ja, das ist die Fähigkeit, Komplexes zu übersetzen. Einstein war so ein Meister der Vereinfachung. Sein Motto war: vereinfache, vereinfache, vereinfache, bis es nicht mehr weiter geht und die Aussage immer noch richtig ist. Manchmal kommen Leute mit Vergleichen, die einfach, aber eben nicht mehr richtig sind. Es gibt da einen Zusammenhang – je besser jemand etwas versteht, desto besser und einfacher kann er es auch erklären. Es braucht Erfahrung, um Dinge ganz einfach erklären zu können. Ein junger Wissenschaftler bedient sich noch des Jargons und der Zahlen, erst ein reifer Wissenschaftler kann Komplexes auf einem wirklich einfachen Niveau erklären und dabei stets korrekt bleiben. Art Schawlow, der Miterfinder des Lasers, ein sehr guter Freund von mir, hatte diesen Spruch. „Erst wenn du wirklich ein weiser Physiker geworden bist, bist du möglicherweise dafür bereit eine Anfängerklasse zu übernehmen. (lacht)“
Können Sie das weiter ausführen?
„In Stanford schicken wir junge Lehrer in die höheren Klassen. Aus zwei Gründen: erstens, wenn sie wirklich schlecht sind, ist das nicht so tragisch, die höhersemestrigen Studierenden werden es verkraften. Zweitens, rutschen Lehrende in den Anfängerklassen leichter in den Wissenschaftsjargon, bemühen die Mathematik, etc. – man muss da sein Fach noch nicht so genau verstehen. Man würde annehmen, dass es bei den Höhersemestrigen um ein tieferes Verständnis geht, aber das stimmt nicht. 99,95 Prozent der besten Ideen kommen davon, Wissenschaft auf einem sehr grundlegenden Niveau zu verstehen.“
Hat die Politik sie desillusioniert? Hat sich an ihrem Vertrauen in die Politik etwas geändert?
In der Politik gibt es viel mehr Verleumdung als in der Forschung. Aus vielen Gründen, wie wir wissen. Wenn ihre Frage auf Verleumdungen abzielt, auf Belanglosigkeiten, darauf, dass man eine Position nicht aufgrund von Vernunft oder Studien einnimmt, sondern aufgrund von Wahlkampfspenden – so gehört das einfach zum politischen Alltag in Amerika. Ich habe einige wirklich großartige politische Führer getroffen, die sich davon abheben wollten, aber das ist schwierig.“