Der Legende nach verliebt sich Narziss in sein eigenes Spiegelbild, das ihm im Wasser erscheint. Als der junge Jäger kapiert, dass seine Liebe so nie erwidert werden kann, bringt er sich um. In einer anderen Version fällt ein Blatt auf das Wasser, bedeckt das gespiegelte Gesicht. Narziss ist von seinem vermeintlich grausigen Anblick sehr verstört. Und wieder bringt er sich um.
Daran angelehnt hat sich im Volksmund wie auch in der Forschung der Begriff des Narzissmus eingebürgert. Dr. Emanuel Jauk vom Institut für Psychologie an der Uni Graz erklärt das so: Ein Narzisst erkennt man an seinen Gefühlen „von Grandiosität, Überlegenheit gegenüber anderen und der übertriebenen Wichtigkeit des eigenen Selbst gegenüber anderen“.
Im Alltag sind Narzisstinnen und Narzissten dominant, ich-bezogen. So kann es zu Konflikten kommen. Dr. Jauk führt fort: „Wenn jemand sehr auf seine eigenen Interessen bedacht ist, dann funktioniert manchmal der Interessensausgleich mit anderen nicht reibungslos.“
Aufs Hirn geschaut: Wie man Narziss heute findet
Jauk wollte mit einer Kollegin und drei Kollegen in einem Experiment die Ursachen dieses Persönlichkeitsbildes ergründen. Nun kann man aber Versuchspersonen schlecht fragen, ob sie besonders eitel sind. Solche Selbstbefragungen erweisen sich oft als ungenügend. Auch ich-bezogene und dominante Menschen würden sich nämlich kaum das negativ behaftete Label Narzisst umhängen. Also hat Dr. Jauks Team eine experimentelle Studie durchgeführt, bei der es anfangs über Umwege feststellte, wer als Narzisst gelten kann und wer nicht. Erst im zweiten Schritt erforschten sie dann die Gehirne der so definierten Gruppen.
Aus einem großen Pool (insgesamt 600 Menschen) wurden 43 Versuchspersonen ausgesiebt. 21 Probandinnen und Probanden wurden so als hoch narzisstisch definiert. 22 galten als gering narzisstisch. Das mag als geringe, wenig repräsentative Fallzahl erscheinen, doch die Vorbefragung allein hat schon hohe Maßstäbe gesetzt. Danach wird es erst richtig tricky. Betrachten wir davor die Ergebnisse genauer. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden in einem Magnetresonanztomografen (MRT) Fotos von sich, dem besten Freund beziehungsweise der besten Freundin und eines ihnen äußerlich ähnlichen Fremden gezeigt.
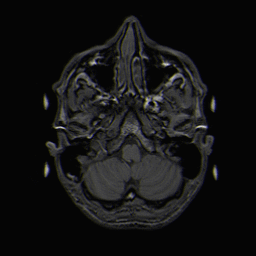
Die Forscherin und Forscher der Uni Graz beobachteten nun die Gehirnaktivierung von besonders narzisstischen Personen, während diese die Fotos anschauten. „Haben sie ein überhöht positives Selbstbild, sollte das Betrachten jene Gehirnareale aktivieren, die für starkes Verlangen oder Genussreaktionen verantwortlich sind. Trifft der gegenteilige Fall zu, sollten Regionen aktiviert werden, die auf negativen Affekt oder emotionale Konflikte schließen lassen“, beschreibt Jauk die Ausgangslage.
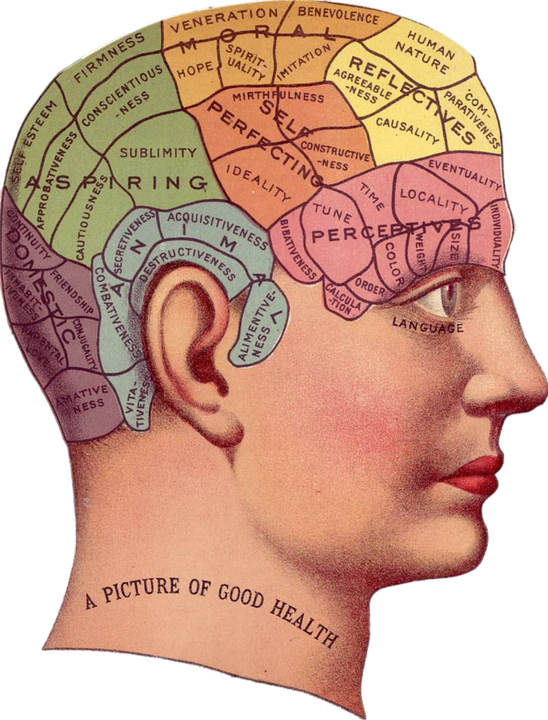
Selfies: Die arrogante Gesellschaft?
Die 2016 durchgeführte Studie liefert überraschende Ergebnisse. So zeigt sie auf, dass Narzisstinnen und Narzissten von ihren Portraits, entgegen alltäglicher Erwartungen, eher beunruhigt als erfreut waren.
Jauk überrascht das wenig. Der Wissenschafter beschreibt im Gespräch mit Schrödingers Katze die Vorbefragungen: „Es gibt etwas, über das die Leute auf bewusster Ebene urteilen: „Ich bin ganz super und eigentlich allen überlegen.“ Und dann gibt es aber etwas anderes, was vermutlich auf unbewusster Ebene stattfindet, wo aktive Unsicherheit da ist. Und die kann man triggern, wenn man Leute mit besonders selbstrelevanten Reizen konfrontiert. Und da gehören die Fotos vom eigenen Gesicht ganz besonders dazu.“
Vielen, etwa Felix Stephan in der Wochenzeitung Die Zeit, gilt die heutige Gesellschaft mit ihrem Drang zur Über-Individualität mit ihren Selfies als arrogante, als narzisstische Gesellschaft. Könnte man die Studie so deuten, dass gerade Selfies in sozialen Medien eher als Hilferuf zu lesen sind? Gilt also eher die Frage „Bin ich eh toll?“ anstelle der protzigen Feststellung „Schaut, wie toll ich bin!“? Von Portraits wie in der Studie zu Selbstportraits in Sozialen Medien ist es schließlich nicht allzu weit. 
Der Psychologe zögert, in Ansätzen könnte man das aber schon so betrachten: „Zumindest dann, wenn das Selfie-Posten dem Zweck dient, dass man besonders viel Bestätigung von Außen erfährt, dass man besonders viele Likes bekommt. Dann ist das vermutlich in bestimmten Teilen schon narzisstisch motiviert. Ich denke, das ist eine sehr intuitiv zugängliche Überlegung, die viele aus ihrer Erfahrung wahrscheinlich teilen würden. Wenn man mit sich selbst eh zufrieden und im Reinen ist, dann gibt es keinen Grund, dass man ständig hören muss, wie toll man ist.“
Bleiben wir noch kurz bei Selfies: Jauk und sein Team sind sehr vorsichtig in der Interpretation der eigenen Ergebnisse aufgrund der geringen Anzahl an Probandinnen und Probanden. Ihre Studie kann auch nichts zur These sagen, ob Selfies zu einer narzisstischen Gesellschaft beitragen, schließlich ging es um Portraits, nicht Selbstportraits.
Dennoch kennt Jauk andere wissenschaftliche Hinweise: „Es gibt groß angelegte Langzeitstudien in den USA, wo das Phänomen vielleicht noch ein bisschen drastischer zutagetritt, wo ziemlich gut sichtbar ist, dass über die vergangenen Jahrzehnte ein Anstieg im Narzissmus zu verzeichnen ist. Das wird auch mit dem Fragebogen, den wir eingesetzt haben, untersucht, und da steigen die Werte konstant an.“
Mr. Sensibel und Herr Empfindsam
Außerdem ergab das Experiment an der Uni Graz: Männliche Narzissten sind sensibler als weibliche. Das heißt konkret, Männer sind empfindlicher gegenüber möglicherweise gefährlichen Situationen, heißt es in der Studie. Emanuel Jauk stellt eines vorweg: „Wir wissen selber nicht genau, warum wir diesen Effekt bei Männern finden konnten und bei Frauen nicht.“ In der Studie verweisen die Autorin und die Autoren darauf, dass Frauen eher auf ihr soziales Umfeld zurückgreifen als Männer.
Jauk beschreibt das als „einen gewissen Sicherheitspolster“ und er meint das völlig positiv: „Vermutlich liegt das daran, dass Frauen im Durchschnitt betrachtet durchaus das emotional kompetentere Geschlecht sind und ihre eigenen Emotionen besser wahrnehmen, verstehen und regulieren können, als es Männer im Durchschnitt können.“ Ein Problem anzusprechen, soziale Unterstützung zu suchen, wäre laut Emanuel Jauk eine Möglichkeit, „wie man mit belastenden Situationen umgehen kann. Das machen Frauen zum Beispiel eher als Männer“.
Spott und Häme?
Wie die Ergebnisse der Grazer Studie aufzeigen, sind Narzisstinnen und Narzissten alles andere als arrogant. Daher sollte sich der Umgang mit ihnen ändern. Jauk schickt voraus, dass zunächst eine Einstellungsänderung nötig ist. Dazu „können Ergebnisse wie die unsrigen beitragen“, ist er überzeugt. Jedenfalls sperrt sich der Forscher dagegen, dass man den „einfachen Weg geht, der derzeit in vielen Massenmedien gewählt wird, dass man sagt: Menschen mit narzisstischer Persönlichkeit sind einfach von Grund auf böse und verurteilungswürdig“.
Er ist überzeugt, dass Studien wie jene in Graz zeigen können, „dass es schon eine tieferliegende Schicht zu verstehen gibt und dass einfach niemand von Grund auf böse ist“. Wer das einmal eingesehen hat und seine Einstellung entsprechend verändert, bei dem, so glaubt Jauk, ändert „sich das Verhalten daraufhin von selbst“.
Fotos und ab in die Röhre
Jauk erklärt das Studiendesign genauer: „Es gibt da Selbstbeschreibungs-Fragebogen mit insgesamt 40 Fragen, wo man bei jeder Frage jeweils eine Aussage ankreuzt, die einen eher beschreibt. Da stehen so Sachen drin wie: „Bescheidenheit ist nicht meine Sache, ich bin der geborene Anführer.“ Oder: „Eines Tages sollte jemand meine Biografie schreiben.“ Und Leute, die dem sozusagen konsistent zustimmen, wurden dann in die hoch narzisstische Gruppe eingeteilt; Leute, die dem konsistent nicht zustimmten, in die gering narzisstische Gruppe.“

Es ist wichtig, zu ergänzen, dass das Forschungsteam „nicht mit klinisch diagnostizierten Narzisstinnen und Narzissten“ arbeitete, „sondern mit Narzissmus in der „normalen“ Bevölkerungsvariation, normal in Anführungszeichen“.
Das heißt, man hat keine Praxen und Kliniken kontaktiert, sondern aus dem Laufpublikum auf der Straße die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie rekrutiert.
Die 43 Auserwählten wurden gebeten, mit ihrem besten Freund, ihrer besten Freundin zu einem Fototermin zu erscheinen. Ein Profifotograf knipste im universitätseigenen Studio 72 Portraits (!) von jeder einzelnen Person. Hinzu kamen Bilder von Menschen, die den Auserwählten jeweils äußerlich ähnelten. Das machte insgesamt stolze 9.288 Fotos.
Sie wurden aus 24 verschiedenen horizontalen und drei verschiedenen vertikalen Winkeln aufgenommen. Die Beleuchtung war standardisiert, also bei ähnlich angelegten Bildern gleich.
Damit nicht genug: Ein paar Wochen später kamen die Versuchspersonen erneut an die Uni. Hier folgte das oben beschriebene MRT. „Das mit den vielen verschiedenen Winkeln“, die vom Fotografen eingenommen wurden, „ist ein methodisches Detail, war aber notwendig, damit die Leute nicht immer ein ähnliches Bild sehen und sich nicht zu sehr darauf einstellen“, ergänzt Dr. Jauk.
Warum war dieser hohe Aufwand notwendig?
„Die neurophysiologischen Gehirnreaktionen, die man erzeugt, wenn man Bilder von sich selbst ansieht, die sind einer bewussten Kontrolle nicht unterworfen“, erklärt Jauk. Die erwähnten Reaktionen „entstehen spontan und unwillkürlich“. Dieser Zugang ermögliche, „Qualitäten, die mit Narzissmus einhergehen, zu untersuchen, die auf bewusster Ebene nicht angegeben werden oder angegeben werden können“, erläutert der Forscher.
Mehr: Emanuel Jauk, Mathias Benedek, Karl Koschutnig, Gayannée Kedia, Aljoscha C. Neubauer: „Self-viewing is associated with negative affect rather than reward in highly narcissistic men: an fMRI study“ Auf Englisch erschienen bei Nature Scientific Reports.
Autor: Zoran Sergievski







