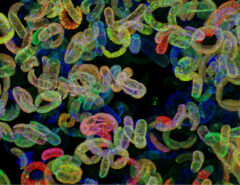Kunststoff umgibt uns überall. Wir bemerken das beim Einkaufen, wenn nahezu alle Produkte in Plastik verschweißt sind. Wir bemerken das an den unzähligen Plastiksackerl, die sich in unserem Haushalt türmen, und am Plastikgeschirr, in dem wir unser Essen fürs Büro einpacken. Und dann gibt es da noch den Kunststoff in unseren Elektronikartikeln oder in unserer Kleidung. Der Kunststoff in unserer Umgebung wirkt sich nicht nur auf die Umwelt, sondern – direkt und über Umwege – auf den menschlichen Körper aus. Können wir überhaupt noch auf Kunststoff verzichten und welche Auswirkungen hätte also ein solcher auf unsere Körper?
Inspiriert vom 2009 erschienen Dokumentarfilm Plastic Planet verzichtete die Familie Krautwatschl größtmöglich auf Kunststoffe im Haushalt. Dazu haben sie auch den Blog http://www.keinheimfuerplastik.at gestartet, auf dem sie von ihrem Vorhaben berichteten. Dort heißt es etwa: „Es geht weder um Verzicht noch um Rigorosität. Vieles kann und will man nicht entbehren, nicht den Computer, den Fernseher, das Handy, den Kühlschrank und den Staubsauger. Doch bei vielen anderen Produkten hat man die Wahl, da sie entweder aus Plastik oder aus Glas, Holz, Metall, Keramik oder pflanzlichen Fasern hergestellt werden.“

Wie wirkt sich Plastikverzicht auf den menschlichen Körper aus?
Bei ihrem Experiment wurden die Familie Krautwatschl von Wissenschaftlern rund um Hans-Peter Hutter vom Institut für Umwelthygenie von der Medizinischen Universität Wien begleitet. Hutter meint im Gespräch mit Schrödingers Katze dazu: „Die Anstrengungen der Familie, jeglichen Kunststoff aus dem Haushalt zu entfernen und über längere Zeit ohne Plastik zu leben, waren weltweit einzigartig. Es gab damit die einmalige Gelegenheit, eine solche Plastikkarenz wissenschaftlich zu untersuchen.“
Zu Beginn des Experiments und nach zwei Monaten wurden Harnproben der Familienmitglieder genommen, um der Frage nachzugehen, wie sich der Kunststoffverzicht auf den menschlichen Organismus auswirkt. Die Ergebnisse wurden vor Kurzem im Journal Environmental Research präsentiert. Hutter und sein Team konnten dabei feststellen, dass die Vermeidung von Kunststoff wenig Auswirkung darauf hat, ob der menschliche Körper mit eben diesem belastet ist. So wurden etwa Spuren von Phthalat-Metaboliten bei der Familie Krautwaschl gefunden. Phthalate werden als Kunststoff-Weichmacher eingesetzt und gelten laut Umweltbundesamt als gesundheitsgefährdend. Sie sind in vielen Produkten enthalten. Der Mensch nimmt sie durch Atemluft und Nahrung auf.
Nicht von allen Kunstoftypen gehen dieselben Gefahren aus. Welche Arten sind besonders problematisch?
Gibt es guten und schlechten Kunststoff?
Welche Auswirkungen hat Kunststoff überhaupt auf den menschlichen Körper? Dazu Hutter: „Bei den gesundheitlichen Auswirkungen von Weichmachern stehen Beeinträchtigungen der Fortpflanzungsfähigkeit im Vordergrund. Daten aus epidemiologischen Studien erbrachten etwa Hinweise auf Beeinträchtigung der Samenqualität bei Männern durch Phthalate und vorzeitige Geschlechtsreife bei Mädchen.“ Zudem sei ein Zusammenhang zwischen einem geschädigten Immunsystem und vermehrten Auftreten von Übergewicht festgestellt worden.
Beim Thema Kunststoff sind sich viele Menschen daher unsicher, welche Arten von Kunststoff gefährlich sind und welche nicht. Hutter nennt PVC (Polyvinylchlorid) aufgrund seiner gesundheits- und umweltschädigenden Wirkung als klassisches Beispiel für einen problematischen Kunststoff. Polyethylen sei dagegen als unproblematisch zu betrachten.
Allgemein sei es jedoch sehr schwer, Kunststoffe in „gut“ und „schlecht“ einzuteilen. Eine Klassifizierung sei immer von den Folgen auf Ökosysteme und Gesundheit abhängig: „So kann z. B. Kunststoffen, bei deren Herstellung die ArbeitnehmerInnen schutzlos bestimmten Schadstoffen ausgesetzt sind, sicher kein gutes Zeugnis ausgestellt werden. Das gilt auch für jegliche Kunststoffprodukte, die in großen Mengen produziert werden und dann achtlos als Müll Hunderte Jahre in der Umwelt verbleiben.“
Kunststoff als Umweltproblem
Kunststoff findet in verschiedenen Bereichen Anwendung, etwa bei Verpackungsmaterialien, Kleidung und in der Industrie. In Österreich werden pro Jahr rund eine Million Tonnen Polymere zu Kunststoffprodukten verarbeitet bzw. für Nicht-Kunststoff-Anwendungen gebraucht.
Dabei ist es vor allem die Umwelt, die unter Kunststoff leidet. Dieses Jahr präsentierte Greenpeace eine Studie, wonach es in 35 Jahren mehr Plastik als Fische im Meer geben wird. Eine Studie des Umweltbundesamt Wien und der Universität für Bodenkultur kam zu dem Ergebnis, dass sich auch in der Donau Plastik befindet. Und erst kürzlich konnten Hamburger WissenschaftlerInnen feststellen, dass die Belastung durch Mikroplastikpartikel in Fluss- und Meeresböden drei- bis vier Mal höher ausfalle als im umliegenden Sedimenten.
Das verwundert Hutter nicht: „Die Ergebnisse überraschen mich nicht. Sie zeigen wieder deutlich auf, wie die Folgen des massenhaften Kunststoffeinsatzes stark unterschätzt wurden. Jedenfalls liegen die Gefahren primär in einer Störung diverser aquatischer Lebensgemeinschaften. Leider sind die ökologischen Folgen z. B. in den Nahrungsketten sowohl wegen der Akkumulation von Mikroplastikteilchen als auch aufgrund der Einlagerung häufig bedenklicher Schadstoffe weder erforscht noch absehbar.“

Reduzierung der Belastung durch Kunststoff dringend nötig
Obwohl das Experiment von Hutter und seinen KollegInnen zeigen konnte, dass der menschliche Organismus auch noch nach mehreren Monaten des Kunststoffverzichts eine gewisse innere Belastung aufweist, plädiert Hutter dafür, die Aufnahme von Chemikalien dennoch nach Möglichkeit zu reduzieren:
„Es ist für die eigene Gesundheit aus vorsorgemedizinischer Sicht immer empfehlenswert, die Aufnahme von Chemikalien – so weit, wie es einem überhaupt möglich ist – zu vermeiden bzw. zu minimieren. Einer bestimmten Hintergrundbelastung, egal, ob Schwermetalle oder Industriechemikalien, entkommt man ohnedies nicht.“
Zudem ist Verringerung von Kunststoff für die Umwelt von Bedeutung. Alleine für die Herstellung von Milliarden Plastikflaschen, die in Deutschland verbraucht werden, seien pro Jahr 665 000 Tonnen Rohöl erforderlich, so Hutter.
Autorin: Barbara Fohringer