Der Atem stockt, das Herz schlägt bis zum Hals und es zittern einem sprichwörtlich die Knie: Man hat Angst. In den meisten Situationen ist sie harmlos, sie überfällt uns gelegentlich bei grusligen Horrorfilmen, in der Dunkelheit oder beim Alleinsein. Umgangssprachlich kommt in solchen Situationen auch oft das Wort Furcht zum Einsatz. Viele kennen dabei gar nicht den Unterschied zwischen den beiden Emotionen. Wissenschaftlich gesehen wird Angst oft von wenig fassbaren Einflüssen ausgelöst, die dadurch zu Beklemmung führen. Die Reaktionen sind bei der betroffenen Person vor allem eine gesteigerte Wahrnehmung und eine Empfindlichkeit der Sinne. „Furcht hingegen wird durch konkrete Objekte oder Situationen ausgelöst, es kommt zu einer Alarmreaktion mit Steigerung von Blutdruck und Atemfrequenz, Freisetzung von Stresshormonen, dem Drang nach Kampf, Flucht oder Verstecken.“ Evolutionstechnisch seien diese Reaktionen lebensnotwendig: „Lebewesen, die in einer gefährlichen Umwelt furchtsam reagieren überleben besser.“, erklärt Dr. Nicolas Singewald.
Wenn die Angst nicht mehr zu stoppen ist
Im Normalfall ist Angst also eine Emotion, die uns vor potentiellen Bedrohungen schützen kann und hin und wieder zum Vorschein kommt. Wenn sie allerdings in ungefährlichen Situationen auftritt, lange anhält und immer wieder in übersteigerter Form ausbricht, spricht man dabei von krankhaften, pathologischen Angstzuständen. Der Neuropharmakologe erklärt, wie viele von dieser Erkrankung betroffen sind: „Jeder fünfte Mensch in der EU wird statistisch gesehen einmal in seinem Leben unter einer Angststörung leiden. Erkannt wird diese Störung oft erst wenn die Lebensqualität schon massiv eingeschränkt ist.“ In schweren Fällen stellt sich das Sozialverhalten der betroffenen Person komplett ein, „Umwelt“ wird zum Fremdwort und es kommt zur Vereinsamung. Die Angst macht damit ein normales Leben unmöglich. „Die Behandlung einer Angststörung sollte also schon viel früher begonnen werden.“
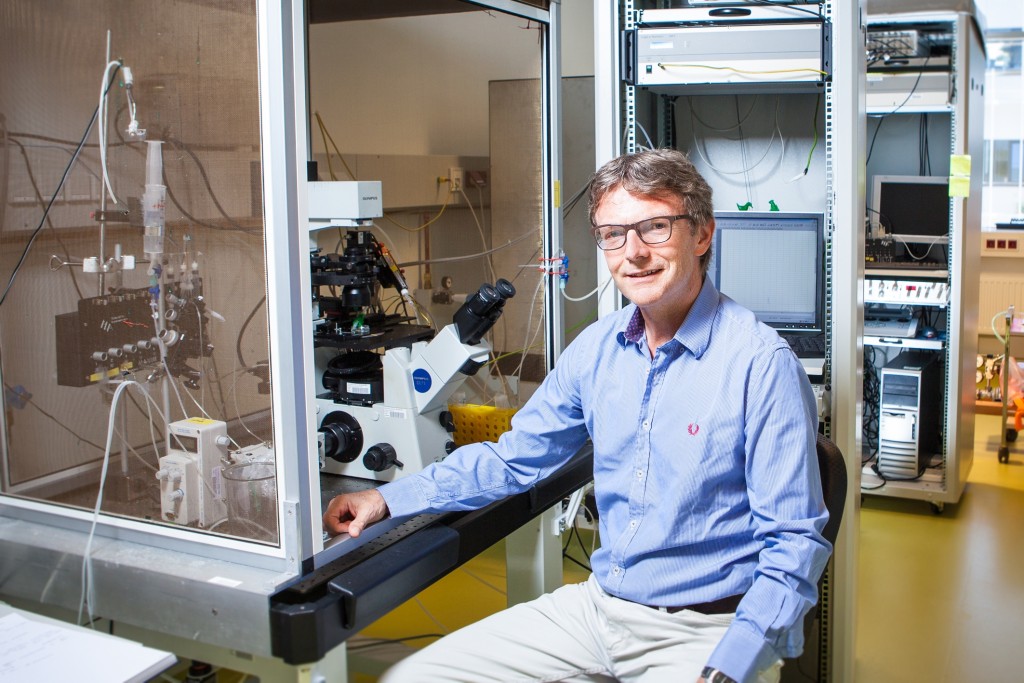
Doch wie wird diese Emotion eigentlich im Gehirn ausgelöst? Viele unserer Ängste sind erlernt und beruhen beispielsweise auf Erinnerungen, die wir als traumatisch empfunden haben. „Wenn jemand als Kind von einem Hund gebissen wurde, legt das Gehirn eine Gedächtnisspur ab, die später auch in Situationen abgerufen werden kann, die nur vage an die traumatische Situation erinnern, wie zum Beispiel nur ein Bellen.“, erklärt der Experte.
„Um eine bestimmte Angst zu verlernen, wird eine neue Gedächtnisspur abgelegt, welche die Furcht-Gedächtnisspur überlagern kann.“ – Dr. Nicolas Singewald
Die Emotion Angst beansprucht dabei verschiedene Bereiche im Gehirn, die mit Botenstoffen ein komplexes System bilden. Die Amygdala, der Hippocampus und der präfontale Cortex sind drei davon. „Die Amygdala ist direkt an der Entstehung von Angst beteiligt. Wird sie elektrisch stimuliert, erhöhen sich Herzschlag- und Atemfrequenz und Blutdruck sowie die Konzentration von Cortisol, was den natürlichen und konditionierten Furcht-Symptomen entspricht.“, so Dr. Singewald. Der Hippocampus hingegen ist für Erinnerungen zuständig und speichert deshalb auch bestimmte Gefahren ab. Und um die Bewertung von Angstreizen kümmert sich der präfontale Cortex, der dadurch auch eine wichtige Funktion beim „Verlernen“ oder der sogenannten „Extinktion“ von Angst übernimmt. Dr. Singewald meint dazu: „Um eine bestimmte Angst zu verlernen, wird eine neue Gedächtnisspur abgelegt, welche die Furcht-Gedächtnisspur überlagern kann.“

Vererbung von Angst
Durch die Komplexität ist dieses Netzwerk fehleranfällig. „Gene und Umwelteinflüsse können zu einer Fehlregulierung beitragen, die in eine Angsterkrankung mündet.“, erzählt Dr. Singewald. Angstzustände können also auch vererbt werden. Dabei handelt es sich aber nicht um ein einzelnes Angstgen, das herzrasende Zustände beim Betroffenen auslöst, sondern um mehrere hunderte, die jeweils die Wahrscheinlichkeit einer solchen Erkrankung erhöhen. Als Umweltfaktoren, die diesen Vorgang tatkräftig unterstützen, zählen laut dem Innsbrucker Neurowissenschaftler Kindheitstraumata, ausgeprägter Stress oder negative Lebensereignisse, wie der Verlust eines geliebten Menschen, zu den häufigsten Auslösern einer Angststörung.
Die Festplatte einfach zu löschen funktioniert nicht
Um eine Angststörung zu behandeln, werden verschiedene Mittel eingesetzt, die von der jeweiligen Art der Erkrankung abhängen. Medikamentös kommen vor allem Antidepressiva wie SSRIs (selektive Serotonin Rückaufnahme-Inhibitoren) zum Einsatz, aber auch Benzodiazepine wie etwa Valium werden bei einigen Patienten angewendet. Da aber nicht jeder Betroffene genetisch gleich ausgestattet ist, sprechen die verabreichten Medikamente nicht immer bei jedem gleich an. Neben Medikamenten werden bei bestimmten Angstformen auch Psychotherapien angeboten, wie etwa bei der Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS). In manchen Fällen liefern diese aber nur kurzfristig Erfolge. „Hier sucht die Forschung nach Wegen durch neuartige Kombination mit anderen Medikamenten den Therapieerfolg schneller, effektiver und damit langanhaltender zu machen.“
Auf der Universität Innsbruck werden deshalb im Projekt „Cell signaling in chronic CNS disorder“ neue Therapiemöglichkeiten bei Angst- und Trauma-assoziierten Erkrankungen erforscht. Da bei vielen Angstpatienten das Extinktionslernen, das im Präfrontalcortex stattfindet, gestört ist, spielt es bei der Angstbewältigung eine große Rolle. „Während der Forschung wurden vom Team am Institut für Pharmazie der der Universität Innsbruck einige Mechanismen entdeckt, die ein stark gestörtes Extinktionslernen wiederherstellen“, erklärt Dr. Singewald. „Der Effekt, der damit erzielt wird, soll so stark werden, dass zukünftige Rückfälle in die Angstsymptomatik langanhaltend, vielleicht lebenslang verhindert werden.“
Die Bewältigung einer Angststörung beim Menschen funktioniert also leider nicht so einfach, wie der Neuropharmakologe weiß: „Die Erinnerung an ein furchtauslösendes oder gar traumatisches Ereignis wird nicht gelöscht, wie auf einer Festplatte. Es stellt sich stattdessen eine Balance zwischen dem Furchtgedächtnis (Amygdala, Hippocampus) und dem Extinktionsgedächtnis (Präfrontalcortex) ein.“ Die Angstbewältigung funktioniert demnach wie eine Waage: Kommt es zu übermäßigem Stress, wird das Furchtgedächtnis gestärkt und gewinnt über längst als überwunden gedachte Ängste wieder die Überhand. Herrscht hingegen Gleichgewicht, ist ein stressfreies und freudvolles Leben für Patienten möglich.
Text: Michaela Pichler




